Team

Senckenberg Görlitz 

Dr. Karin Hohberg
Karin Hohberg studierte Biologie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und promovierte am Lehrstuhl für Tierökologie der Universität Bielefeld zum Thema „Nematoden im Bodennahrungsnetz“. Seit 2009 leitet sie die Sektion Nematoda am Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz. Neben ökologischen Fragestellungen rund um frei lebende Fadenwürmer liegt ihr Forschungsschwerpunkt in Aufbau und Struktur von Artengemeinschaften und Bodennahrungsnetzen, die sie vorrangig in sehr jungen oder hochgradig gestörten Böden in extremen Lebensräumen untersucht, darunter Braunkohletagebaue, antarktische Böden, natürliche CO2-Ausgasungsfelder, heiße Quellen und Sanddünen in der Namib Wüste.
Senckenberg Görlitz 

Dr. Ricarda Lehmitz
Ricarda Lehmitz hat an der Universität Potsdam Biologie studiert. In ihrer Promotion an der Universität Leipzig beschäftigte sie sich mit den Verbreitungswegen von Hornmilben (Oribatida). Seit 2013 leitet sie die Sektion Oribatida innerhalb der Abteilung Bodenzoologie am Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz. Aktuell untersucht sie unter anderem den Einfluss von Störungen und Renaturierung auf die Artenzusammensetzung der Hornmilben in Mooren und erarbeitet die erste Rote Liste der Hornmilben für Deutschland.
Senckenberg Görlitz 

Dr. Nicole Scheunemann
Nicole Scheunemann studierte Biologie an der TU Darmstadt und promovierte im Jahr 2016 an der Universität Göttingen zum Thema Ökologie von Springschwänzen (Collembolen) und deren Stellung im Nahrungsnetz des Bodens. Seit 2018 forscht sie am Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz zur Artenvielfalt und Gemeinschaftsstruktur von Collembolen in norddeutschen Auenwäldern, welchen Einfluss sie auf Ökosystemleistungen haben, und auf welche Art sie am besten zu schützen sind. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Forschung ist die Veränderung von Artengemeinschaften von Bodentieren im Zuge des Klimawandels und die Auswirkungen dieser Veränderungen auf Ökosystemleistungen.
Senckenberg Görlitz 

Dr. Clément Schneider
Clément Schneider studierte Lebens- und Evolutionswissenschaften an der Universität Pierre und Marie Curie, Paris 6. 2014 promovierte er am National Museum of Natural History in Paris über die Taxonomie und Phylogenetik der Collembola. Danach arbeitete er in der Privatwirtschaft als Datenwissenschaftler, der an Projekten im Bereich Big Data und maschinelles Lernen beteiligt war. Seit 2019 ist er zurück in der Wissenschaft, bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (Frankfürt am Main, dann Görlitz), wo er an der Genomik der wirbellosen Bodenfauna arbeitete und nun die Anwendung von KI-Methoden entwickelt, um die Komplexität von Bodenfauna-Gemeinschaften im Allgemeinen zu erfassen und speziell das Wissen über die Artenvielfalt von Springschwänzen auf der ganzen Welt zu erweitern.
Senckenberg Görlitz 

Prof. Dr. Anton Potapov
Anton Potapov ist Bodenökologe und erforscht die Rolle von Tieren für das Funktionieren von Ökosystemen. Er schloss sein Studium an der Staatlichen Universität Moskau 2011 ab und arbeitet seit 2016 in Deutschland. Seit 2024 leitet er die Abteilung für Bodenzoologie am Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz. Seine größte Leidenschaft und Expertise sind Nahrungsnetze im Boden. Er koordiniert das globale Monitoring von Bodentiergemeinschaften - Soil BON Foodweb.
Senckenberg am Meer 

Dr. Sven Rossel
Sven Rossel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung in Wilhelmshaven. Er promovierte 2018 über die Diversität benthischer Copepoden der Nordsee. Neben der taxonomischen Arbeit beschäftigt er sich außerdem mit der Anwendung molekularer Methoden zur schnelleren Identifikation von Organismen. Neben dem genetischen Barcoding liegt ein Fokus dabei beim Proteome fingerprinting, einer Methode, die schnell erzeugte Proteinmassenspektren nutzt um Individuen auf Artebene zu identifizieren.
Senckenberg am Meer 

Prof. Dr. Pedro Martínez Arbizu
Pedro Martínez Arbizu ist Leiter des Deutschen Zentrums für Marine Biodiversitätsforschung in Wilhelmshaven. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit der Taxonomie von benthischen Copepoden und anderer Crustaceen. Neben der taxonomischen Arbeit untersucht Prof. Dr. Pedro Martínez Arbizu die Verbreitung interstitieller Fauna im Flachwasser und der Tiefsee unter Nutzung moderner technischer Lösungen und DNS Methoden. Unter den zahlreichen Projekten, die von ihm geleitet wurden war unter anderem das Census of Diversity of Abyssal Marine Life (CeDaMar) in dem die unbekannte Fauna der Tiefsee erforscht und beschrieben wurde.
Senckenberg am Meer 

PD Dr. Mona Hoppenrath
Mona Hoppenrath studierte Biologie in Göttingen und promovierte 2000 in Hamburg. Als Postdoc war sie an der Biologischen Anstalt Helgoland und der Wattenmeerstation Sylt des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung tätig, bevor sie 2004 an die University of British Columbia, Kanada, wechselte. Sie ist seit 2008 Fachbereichsleiterin der Meeresbotanik des DZMB, Senckenberg am Meer Wilhelmshaven. Ihr Forschungsschwer- punkt liegt auf der Taxonomie, Systematik und Phylogenie der Dinoflagellaten. 2012 habilitierte sie an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, an der sie als Privatdozentin tätig ist.
Senckenberg am Meer 

Dr. Alexander Kieneke
Alexander Kieneke studierte Biologie mit den Schwerpunkten Zoomorphologie und Systematik an der Universität Bielefeld und schloss das Studium 2004 als Diplombiologe ab. Nach seiner Promotion 2008 an der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg trat er eine Postdoc-Stelle in der Abteilung Deutsches Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung (DZMB) des Instituts Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven an. Seit 2012 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am DZMB und erforscht die Merkmalsevolution und Bio- sowie Phylogeographie von Meiofauna-Organismen mit verschiedenen Techniken. Von den kleinen Bodentieren interessieren ihn besonders die Bauchhärlinge (Gastrotricha).
Senckenberg am Meer 

Dr. Sabine Holst
Sabine Holst promovierte an der Universität Hamburg und arbeitet seit 2009 am DZMB Hamburg (Senckenberg am Meer) im Fachgebiet Cnidaria. Im Fokus ihrer Forschungsarbeiten stehen Taxa der Medusozoa (Scyphozoa, Hydrozoa, Staurozoa). Neben morphologischen und taxonomischen Studien werden in der Arbeitsgruppe auch experimentelle Untersuchungen an Lebendkulturen durchgeführt, um die unterschiedlichen Stadien im Lebenszyklus von Cnidaria-Arten zu erforschen.
Senckenberg Müncheberg 

Dr. Lara-Sophie Dey
Lara-Sophie Dey studierte von 2013 bis 2019 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Biologie. 2023 hat sie an der Universität Hamburg ihre Promotion zum Thema Evolution, Taxonomie und Ökologischer Nischenmodellierung der Ödlandschrecken abgeschlossen. Im selben Jahr wurde sie Leiterin des Molekularlabors am Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut in Müncheberg. Ihr Fokus liegt weiterhin auf der Erforschung der Ödlandschrecken, allerdings auch auf der Erfassung und Analyse des Biodiversitätswandels und der Entwicklung von molekularbiologischen Methoden.
Senckenberg BiK-F Frankfurt 

Dr. Valentyna Krashevska
Valentyna Krashevska promovierte 2008 an der TU Darmstadt, wo sie Bodenprotistengemeinschaften in montanen Regenwaldökosystemen entlang eines Höhengradienten untersuchte. Seit 2009 arbeitete sie an der Universität Göttingen im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 990: Ökologische und sozioökonomische Funktionen tropischer Tieflandregenwald-Transformationssysteme, wo sie die Struktur und Funktion des Zersetzersystems in Tieflandregenwald-Transformationssystemen untersuchte. Sie nutzte Umwelt-DNA zum Nachweis der Vielfalt des Bodenmikrobioms und konzentrierte ihre mikroskopischen Arbeiten auf Thekamöben, die schönsten, ältesten und nützlichsten Indikatororganismen. Seit 09.2023 arbeitet sie am Senckenberg-BiK-F an der Standardisierung von genetischen Methoden zur Bewertung der Bodenqualität.
Senckenberg Frankfurt 

Dr. Iliana Bista
Iliana Bista ist Gruppenleiterin (Meta-OMICS) bei Senckenberg in Frankfurt und verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich DNA-basiertes Biodiversitätsmonitoring und Hochdurchsatzsequenzierung. Sie studierte Biologie an der Aristoteles-Universität in Griechenland und promovierte in Molekularer Ökologie an der Bangor-Universität in Großbritannien. Sie arbeitete an der Entwicklung von DNA-basierten Methoden für das Biomonitoring von Süßwasserökosystemen. Sie arbeitete am Wellcome Sanger Institute, der Universität Cambridge (UK) und dem Naturalis Biodiversity Center (Niederlande). Ihre Arbeit konzentrierte sich auf die Sequenzierung von Referenzgenomen und die vergleichende Genomik, mit dem Tree of Life und dem Vertebrate Genomes Project. Sie gründete ihre Gruppe am SGN Frankfurt im Jahr 2023 und arbeitet an der Erforschung der Biodiversität mit Hilfe von eDNA, Metabarcoding und Metagenomik sowie an der genomischen Anpassung an Umweltveränderungen, wobei sie sich hauptsächlich auf Arthropoden und Fische konzentriert.
Senckenberg Görlitz 

Dr. Ulrike Damm
Ulrike Damm studierte an der Universität Rostock mit Abschluss Diplom-Agraringeneurin und promovierte an der Berliner Humboldt-Universität über die Pilzbesiedlung von Weizen und Boden bei unterschiedlicher Bewirtschaftung. Bevor sie als Leiterin der Sektion Mykologie zum Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz kam, war sie an der Universität Stellenbosch, Südafrika, und am jetzigen Westerdijk Fungal Biodiversity Institut in Utrecht, Niederlande, tätig. Sie erforscht Diversität, Taxonomie und Systematik phytopathogener Pilze, besonders der Gattung Colletotrichum (Pilzkultur in Abb.). Weltweit gibt es fast 1000 beschriebene Colletotrichum-Arten, etwa 350 sind mit DNA-Sequenzen belegt und gelten als „accepted“, aber die wirkliche Anzahl der Arten ist unbekannt. Etwa 30 Arten sind in Deutschland bekannt. Wie die meisten Mikropilze ist die Gattung hier noch weitgehend unerforscht. In Habitaten in Deutschland wie dem Holz von Prunus-Bäumen - ein weiterer Forschungschwerpunkt - gibt es noch zahlreiche unbekannte Arten; über deren Biologie und Bedeutung wissen wir fast nichts.


Dr. Michael Orr
Mein Forschungsprogramm zur Biodiversität und Systematik der Bienen dreht sich um die Frage, wie und wo sich die Bienen entwickelt haben und wie sich dies auf ihre heutige Verbreitung auswirkt, mit dem letztendlichen Ziel, sie und die unschätzbaren Bestäubungsleistungen, die sie erbringen, zu erhalten. Als interdisziplinärer Systematiker beschäftige ich mich mit diesen Fragen durch hochintegrative, kollaborative Methoden, die auf modernen, sammlungsbasierten taxonomischen und systematischen Praktiken beruhen und sich auf die Bereiche Ökologie, Evolution und darüber hinaus ausdehnen. Geleitet von unschätzbaren Daten aus naturhistorischen Sammlungen, verbinde ich Phylogenetik und andere molekulare Ansätze mit morphologischer Analyse, Verhaltensbeobachtung und räumlicher Modellierung, um ihre Geschichte darzustellen und die Zukunft der Bienen auf der Erde zu sichern.

Prof. Dr. Ricardo J. Pereira
Ricardo Pereira ist Evolutionsbiologe und leitet die Abteilung für Biodiversitäts-Monitoring am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart. Seine Forschung konzentriert sich auf das Verständnis der genomischen Vielfalt innerhalb von Arten und deren entscheidende Rolle bei der Erhaltung der Arten- und Ökosystemvielfalt im Angesicht von Umweltveränderungen. Mithilfe von genomischen Werkzeugen und Museums- und Monitoring-Sammlungen untersucht seine Forschungsgruppe, wie die heutige genetische Vielfalt die Resilienz und Anpassungsfähigkeit beeinflusst. Er setzt sich für die Ausbildung der nächsten Generation von Wissenschaftlern ein und arbeitet intensiv mit der Universität Hohenheim und anderen internationalen Partnern zusammen, um die drängenden Herausforderungen im Bereich des Biodiversitätsschutzes anzugehen.

MSc Cristina Vasilita
Mein Hauptforschungsinteresse gilt der Diversifizierung und Evolution von hyperdiversen Gruppen von Arthropoden, wie z. B. den parasitoider Wespen der Überfamilie Platygastroidea. Ich arbeite an Taxonomie-Tools der nächsten Generation, um hyperdiverse Gruppen durch die Entwicklung von Best Practices für komplexe Fragen bezüglich der Vielfalt, der Lebensgeschichte und der Evolutionstrends in diesen Organismengruppen zu untersuchen. Mein Schwerpunkt liegt auf der Erweiterung des Verständnisses und des Wissens, das wir besitzen, indem wir leistungsstarke Bildgebungsverfahren (CLSM, Mikrofotografie, Mikro-CT) mit einem molekularen Ansatz der nächsten Generation (Megabarcoding, Nanopore-Sequenzierung) kombinieren.


Prof. Dr. Hans-Peter Grossart
Hans-Peter Grossart ist Leiter der Arbeitsgruppe Aquatische Mikrobiologie am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) und Professor für Aquatische Mikrobielle Ökologie und Funktionelle Biodiversität an der Universität Potsdam. Er studierte Biologie an den Universitäten Mainz und Konstanz und promovierte am Limnologischen Institut der Universität Konstanz über die Diversität und biogeochemische Rolle von Aggregat-assoziierten Bakterien. Nach einem Postdoc am Yigal Allon Kinneret Limnological Laboratory in Tiberias, Israel, und einem weiteren Postdoc am Scripps Institute for Oceanography in San Diego, USA, war er Assistent am Institut für Chemie und Biologie der Meeresumwelt an der Universität Oldenburg. Seit 2002 ist er Forschungsgruppenleiter am IGB, wo er sowohl die Vielfalt als auch die ökologische Rolle mikrobieller Gemeinschaften in einer Vielzahl von Gewässern untersucht. Sein Hauptinteresse gilt den Süßwasserökosystemen als Hotspots im Erdsystem. Im Erdsystem spielen insbesondere Süßwasserökosysteme eine zentrale Rolle bei der Bindung von Kohlenstoff und der Regulierung der natürlichen Treibhausgasdynamik. Gleichzeitig sind sie Hotspots der Biodiversität und biochemischer Prozesse, da sie Zwischenphasen und Grenzschichten zwischen terrestrischer und aquatischer Umwelt bilden. Dieses hohe Potenzial aquatischer Ökosysteme für naturbasierte Lösungen muss gesichert und besser verstanden werden. Ich stelle mir vor, dass die Forschung der Abteilung zu den ökologischen Folgen des globalen Wandels gut mit verschiedenen nationalen und internationalen Initiativen wie dem GLEON-Netzwerk, dem DFG-Projekt NFDI4-Biodiversität oder dem Leibniz-Labor „Systemische Nachhaltigkeit“ verknüpft werden kann, für das der Wasserkreislauf von besonderer Bedeutung ist.
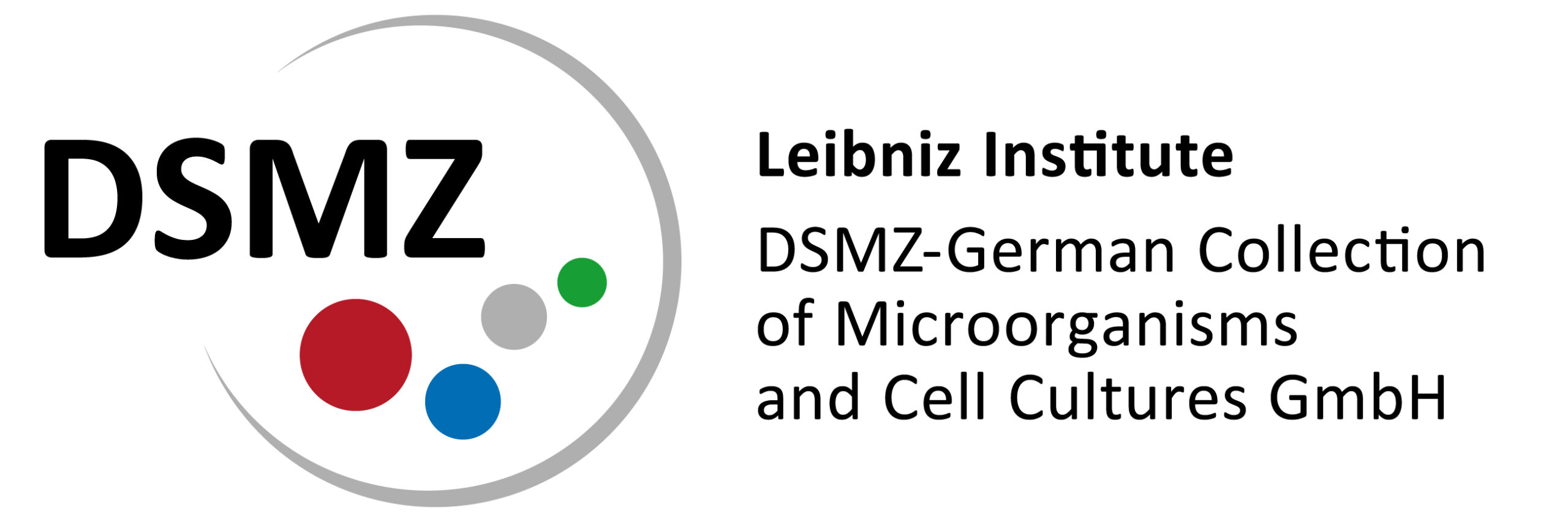

Dr. Cecilia G. Flocco
Cecilia G. Flocco ist eine interdisziplinäre Wissenschaftlerin und Beraterin für Umweltpolitik, die an der Schnittstelle zwischen Biotechnologie und Umweltwissenschaften mit Mikrobiologie und Biodiversitätsforschung arbeitet. Sie ist die wissenschaftliche Koordinatorin des Leibniz Biodiversitäts-Hub am Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH* (Braunschweig, Deutschland). Ihre aktuellen Forschungsinteressen umfassen das Verständnis der Dynamik mikrobieller Gemeinschaften in extremen Umgebungen und wenig erforschten Lebensräumen, wie z. B. in Polarregionen (Antarktis) und in Kulturgütern, sowie die Förderung interdisziplinärer Ansätze in der Mikrobiomforschung. Sie erwarb einen MS in Biochemie, einen MS in Pharmazie und einen PhD in Biotechnologie an der Universität von Buenos Aires, Argentinien, und verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Forschungserfahrung in Amerika, Europa und der Antarktis.

Prof. Dr. Jörg Overmann
Jörg Overmann studierte Biologie an den Universitäten Bochum sowie Freiburg und promovierte 1991 in Mikrobiologie an der Universität Konstanz. Seine Dissertation wurde mit dem Promotionspreis der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM) ausgezeichnet. Nach einem Postdoktoranden-Aufenthalt an der University of British Colombia (Kanada) habilitierte er an der Universität Oldenburg im Jahr 1999. Von 2000 bis 2010 hatte Jörg Overmann eine Professur für Mikrobiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne, und war dort auch Direktor des Departments Biologie. Seit 2010 ist er wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH* in Braunschweig sowie Professor für Mikrobiologie an der Technischen Universität Braunschweig. Seine Arbeitsgebiete sind die bakterielle funktionelle Diversität, bakterielle Populationsgenomik und Artbildung sowie molekulare Mechanismen bakterieller Interaktionen. Prof. Overmann erhielt im Jahr 2013 den Inaugural Douglas Leigh Lecturer Award der Waksman Foundation for Microbiology und im Jahr 2022 den Wissenschaftspreis `Forschung in Verantwortung´ des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft. Er ist derzeit Mitglied der Ständigen Senatskommission der DFG für Grundsatzfragen der Biologischen Vielfalt und Sprecher des Council of Scientists der Human Frontier Science Program Organization (Strasbourg, Frankreich). Er ist zudem Mitglied in mehreren Aufsichtsgremien und wissenschaftlichen Beiräten nationaler und internationaler Institutionen.
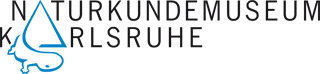

Dr. Judith Bieberich
Judith Bieberich ist Botanikerin und Koordinatorin der „Karlsruher Taxonomie-Initiative“. Sie hat 2021 an der Universität Bayreuth am Zentrum für Ökologie und Umweltforschung (BayCEER) in der Invasionsbiologie promoviert. Wissenschaftlich interessiert sie sich für Vegetationsveränderungen im Globalen Wandel und für Interaktionen von Arten untereinander und mit der Umwelt. Seit 2022 koordiniert sie am SMNK das Projekt „Artenkenntnis für alle. Die Karlsruher Taxonomie-Initiative“, das durch die Stiftung Naturschutzfonds aus zweckgebundenen Erträgen der Glückspirale gefördert wird. So ist sie verantwortlich für die Vermittlung von Artenkenntnis und taxonomischem Wissen am SMNK und für die Kooperation mit anderen regionalen Akteuren in diesem Bereich.

Prof. Dr. Rainer Bussmann
Rainer W. Bussmann ist ein deutscher Botaniker und Vegetationsökologe mit den Schwerpunkten Ethnobotanik und Ethnobiologie, essbare Wildpflanzen, wilde Nutzpflanzenverwandte, Klimawandel, gastronomische Botanik und Bewahrung traditionellen Wissens. Er hat an der Universität Bayreuth, der University of Hawaii, der University of Texas, und am Missouri Botanical Garden gearbeitet. Jetzt hält er eine Professur in Ethnobotanik an der Ilia Universität in Tiflis, Georgien, und ist Leiter des Referats Botanik am Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe. Er hat mehrere internationale Nicht-Regierungsorganisationen gegründet, darunter Nature and Culture International, Saving Knowledge und Ethnomont.

Dr. Hubert Höfer
Hubert Höfer hat an der Universität Ulm Biologie studiert und 1990 über die Spinnengemeinschaft in einem Schwarzwasser-Überschwemmungswald in Zentralamazonien promoviert. Er hat zur Taxonomie und Ökologie der Spinnen in südamerikanischen Regenwäldern und der Bedeutung der Bodentiere in neotropischen Agroforstsystemen und Sekundärwäldern geforscht. Seit 2001 ist er Kurator für Spinnentiere (und andere Wirbellose) und Leiter der Biowissenschaften am Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe (SMNK). Aktueller Schwerpunkt seiner Arbeit am Museum ist die Faunistik und Ökologie einheimischer Spinnen, u. a. in Blockhalden im Nationalpark Schwarzwald, sowie die Mobilisierung von Sammlungs- und Studiendaten für ökologische Auswertungen.

Prof. Dr. Martin Husemann
Martin Husemann ist Evolutionsbiologe und Taxonom und beschäftigt sich vor allem mit Heuschrecken, aber auch anderen Tiergruppen. Er hat in Osnabrück Biologie der Organismen studiert und seinen Doktor an der Baylor University in Texas erworben. Er war sieben Jahre lang Kurator für Insekten im Hamburger Naturkunde Museum bevor er 2023 Direktor des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe wurde. Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten ist er auch stark an der Vermittlung von Naturwissen interessiert.

Dr. Florian Raub
Florian Raub studierte Diplom-Biologie in Karlsruhe und promovierte im Jahr 2016 zum Thema „Diversity and ecology of spider assemblages in secondary forests of the southern Mata Atlântica, Brazil – Implications for environmental conservation”. Nach der Arbeit in mehreren Projekten am arbeitet er seit 2020 als Datenkurator am SMNK und betreut die Erfassung und Verarbeitung wissenschaftlicher Daten im wissenschaftlichen Datenbanksystem Diversity Workbench sowie die Veröffentlichung der Daten in verschiedenen eigenen und externen Internetportalen.

Dr. Markus Scholler
Markus Scholler ist ein Biologe mit Schwerpunkt Ökologie und Taxonomie der Pilze. Neben pflanzenpa-rasitischen Rostpilzen interessiert er sich auch für symbiontische Pilze, z. B. Trüffeln. Er begann 2003 als Mykologe und Kurator für die Pilz- und Algensammlungen am Naturkundemuseum Karlsruhe. Neben der Forschung ist er auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit aktiv (z. B. Pilzberatung für die Giftnotzentra-le, Pilzausstellungen, Leitung einer Pilzarbeitsgruppe). Er studierte Biologie an der Freien Universität Berlin, promovierte an der Universität Greifswald, danach war er Hochschulassistent und wechselte schließlich für mehrere Jahre in die USA um als Kurator an der Purdue Universtity zu arbeiten.

Dr. Björn M. von Reumont
Björn M. von Reumont ist ein Evolutionsbiologe, der am Forschungsmuseum Koenig in Bonn über die Evolution von Krebstieren und Hexapoden promoviert hat. Sein Spezialgebiet ist die Evolution von Gliederfüßern und die Anpassung von Gift (Genen) als hochgradig konvergentes Merkmal bei Krebstieren, Insekten und anderen wirbellosen Tieren. Methodisch setzt er eine Kombination aus klassischen morphologischen Techniken und modernen -omics-Ansätzen ein, einschließlich Transcriptomics, Genomics und Proteomics. Mit seinem Hintergrund in DataScience und Bioinformatik erforscht er auch die Anwendung von künstlicher Intelligenz in den Bereichen Genentwicklung, Biodiversitätssammlung und -überwachung. Seit Januar 2025 ist er der Leiter der Entomologie am SMNK Karlsruhe.

Dr. Reza Zahiri
Der iranisch-kanadische Evolutionsbiologe Reza Zahiri ist ein Spezialist für Lepidoptera. Nach Abschluss seines Bachelor- und Masterstudiums im Iran war er von 2004 bis 2008 Kurator der Lepidoptera-Sammlung am HMIM (Teheran, Iran). Im Jahr 2008 zog er nach Turku (Finnland), um unter der Leitung von Prof. Niklas Wahlberg zu promovieren, und verteidigte seine Doktorarbeit im Juni 2012 erfolgreich. Er konzentrierte sich auf übergeordnete Phylogenien mit mehreren Genen und überarbeitete grund-legend das allgemeine Verständnis der Beziehungen innerhalb der Überfamilie Noctuoidea. Nach sei-ner Promotion ging Zahiri für ein dreijähriges Postdoc-Stipendium nach Kanada an die University of Guelph (Centre for Biodiversity Genomics) in das Labor von Prof. Paul Hebert, wo er eine DNA-Barcode-Bibliothek für 3 700 nordamerikanische Noctuoid-Arten zusammenstellte. Bald darauf, im Jahr 2015, begann er ein weiteres Postdoc-Stipendium bei der kanadischen Regierung in Ottawa, um mole-kulare Schlüssel zur Erkennung invasiver Arten zu entwickeln, die in das Land eindringen. Im Jahr 2016 wurde Zahiri eine Stelle als Lepidopterologe im Entomology Diagnostic Laboratory der Canadian Food Inspection Agency (CFIA) in Ottawa angeboten. Im Jahr 2020 verbrachte er ein Sabbatical als Lepidop-tera-Kurator am Zoologischen Museum der Universität Hamburg. Schließlich trat er im Jahr 2023 eine neue Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe (SMNK) an. Die neue Stelle umfasst Insekten-Biomonitoring, Metabarcoding, Biodiversitätsrobotik und die Langzeitlagerung von Proben für zukünftige Studien.


Prof. Dr. Bernhard Misof
Bernhard Misof ist Generaldirektor des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) mit den beiden Forschungseinrichtungen Museum Koenig Bonn und dem Museum der Natur Hamburg und Professor für Spezielle Zoologie an der Universität Bonn. Der gebürtige Österreicher promovierte 1995 an der Universität Wien, war 1991-1995 Fellow am Center of Computational Ecology, Yale, USA. Nach Schrödinger & von-Humboldt Fellowships als PostDoc erhielt er seine Habilitation und Venia Legendi 2002 an der Universität Bonn. In der ersten Dekade des neuen Jahrtausends war er Kurator für Niederen Arthropoden und Leiter des Molekularlabors am ehem. Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK). In Hamburg leitete er von 2008 - 2010 die Entomologischen Abteilung des Biozentrums Grindel & des Zool Museums und war Sprecher des Zoologischen Museums der Universität Hamburg. 2010 übernahm er in Bonn die Leitung des neu gegründeten Zentrums für Molekulare Biodiversitätsforschung (zmb) und war stellvertretender Direktor des Leibniz-Instituts. Forschungsinteressen und Forschungsgebiete sind alle Aspekte der molekularen Biodiversitätsforschung, von der molekularen Taxonomie bis hin zur evolutionären Genomik (bspw. Molekulare Systematik, Artbildungsprozesse, Entwicklung von rRNA-Molekülen, seltene genomische Veränderungen als phylogenetische Marker, Entwicklung der Hexapoden, evolutionäre Genomik) und umfasst Aspekte der Bioinformatik, Phylogenomik, Speziationsforschung und theoretische Arbeiten. Ob involviert in diverse DFG-Schwerpunktprogramme (Deep Metazoan Phylogeny) oder als Leiter internationalen Forschungsprojekte (z.B. 1KITE, CaBOL), als Mitglied in nationalen und internationalen Aufsichtsgremien und wissenschaftlichen Beiräten oder als Direktor des LIB vertreten in diversen Großprojekten, ist ihm die Integration theoretischer, bioinformatischer und empirischer Arbeiten, mit welcher sich das Potential der Biodiversitätsforschung ausschöpfen lässt besonders wichtig - für naturbasierte Lösungen, die Transformation unserer Gesellschaft und für eine lebenswerte Zukunft.
LIB Hamburg 

Dr. Nancy Mercado Salas
Nancy Mercado Salas hat im Dezember 2013 am El Colegio de la Frontera Sur (Mexiko) promoviert. Nach einem Postdoc am Deutschen Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung (Senckenberg am Meer, Wilhelmshaven) wurde sie Kuratorin und Leiterin der Sektion Crustacea am Centrum für Naturkunde (CeNak - Universität Hamburg). Mit der Fusion von CeNak und ZMFK setzt sie ihre Tätigkeit in der Crustacea-Sektion des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) fort. Ihre Forschung konzentriert sich auf das Verständnis der evolutionären Prozesse, die die Vielfalt der Krebse geformt haben, insbesondere die Prozesse, die mit der Besiedlung und Etablierung in neuen Lebensräumen zusammenhängen. Ihr besonderes Interesse gilt Umgebungen, die „lebende Laboratorien“ darstellen (z. B. Phytotelmata, Anchialin-Höhlen und Grundwassersysteme), in denen wir eine Vielzahl von Fragen im Zusammenhang mit Artbildung, Biogeografie, Populationsgenetik und Evolution verfolgen können. Nancys taxonomisches Fachwissen bezieht sich auf die Unterklasse der Copepoda, insbesondere auf Mitglieder der Ordnung Cyclopoida und ausgewählte Gruppen der Harpacticoida. Sie ist auch an neuen bildgebenden Verfahren (z. B. CLSM-Mikroskopie) und molekularen Werkzeugen (z. B. Barcoding, Metabarcoding) interessiert, die dazu beitragen, die Beschreibung von Arten und Gemeinschaften der Meiofauna zu beschleunigen.
LIB Hamburg 

Dr. Jenna Moore
Jenna Moore schloss im Dezember 2019 ihre Promotion an der University of Florida (USA) ab. Ihr Schwerpunkt lag auf der Evolution und Systematik mariner Anneliden. Im Jahr 2020 erhielt sie ein NSF-Postdoktorandenstipendium und arbeitete am Dauphin Island Sea Lab (USA) an der morphologischen Evolution mariner Anneliden. Anfang 2022 kam sie als Kuratorin und Leiterin der Abteilung Annelida zum LIB. Ihre Forschungsinteressen sind die Evolution von Form und Funktion, Systematik, Taxonomie und Biogeographie mariner wirbelloser Tiere, insbesondere mariner Anneliden. Jennas taxonomischer Schwerpunkt liegt auf den marinen Annelida, insbesondere der Familie Chaetopteridae, aber auch auf anderen marinen Anneliden. Sie setzt moderne bildgebende und molekulare Verfahren ein, um die Entdeckung der biologischen Vielfalt zu beschleunigen, Arten zu charakterisieren, ihre Evolutionsgeschichte zu rekonstruieren und die Zusammenhänge in der Meereswelt zu verstehen. Ihr besonderes Interesse gilt den unbekannten Arten aus dem Flachwasserbereich der Meere, aber sie hat auch an Arbeiten auf Schiffen in der Antarktis und den Subtropen teilgenommen. Jenna Moore verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit der Makrofotografie im Feld, der Entnahme von Gewebeproben, der Konservierung und der schnellen musealen Erfassung aller marinen Makroinvertebratengruppen, um die Artenvielfalt umfassend zu erfassen und Daten zur biologischen Vielfalt offen und zugänglich zu machen.
LIB Bonn 

Dr. Ralph S. Peters
Ralph S. Peters ist Wissenschaftler, Entomologe und Kurator. Seinen Doktor erwarb er an der Universität Hamburg; seit 2011 arbeitet er am Museum Koenig Bonn, Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Seine Hauptforschungsinteressen sind die Taxonomie, Biologie und Evolutionsgeschichte der Hymenopteren, mit einem Schwerpunkt auf parasitoide Wespen. Er bearbeitet diese Forschungsinteressen mit einem interdisziplinären und integrativen Ansatz, der Morphologie, Verhalten und Feldstudien, DNA Barcoding, „Taxonomics“, Phylogenomik und vergleichende Genomik umfasst. Er kuratiert außerdem eine große wissenschaftliche Sammlung am Museum Koenig Bonn und trägt aktiv zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Wissenstransfer des Museums bei. Im Rahmen seiner Forschung war er Co-Koordinator des 1KITE Projektes zur Insektenevolution und leitet zurzeit das Projekt GBOL III: Dark Taxa, eine Biodiversitätsentdeckungs- und DNA-Barcodinginitiative mit Fokus auf schlecht bearbeitete megadiverse Insektengruppen in Zentraleuropa.
LIB Bonn 

Dr. Vera Rduch
Vera Rduch arbeitet seit 2014 für das German Barcode of Life (GBOL) Projekt am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels – Museum Koenig Bonn. Seit Jahresbeginn 2019 erfüllt sie die Aufgabe der Zentralen Koordination des GBOL-Konsortium. Damit war und ist sie entscheidend an der Entwicklung und erfolgreichen Durchführung von GBOL III: Dark Taxa beteiligt. In diesem Projekt, eine Barcoding- und Biodiversitäts-Initiative, werden sich gegenseitig bedingend der Ausbau der DNA-Barcode-Referenzbibliothek, die Erforschung der Dark Taxa (ausgewählte Gruppen der parasitoide Wespen und nematoceren Diptera) sowie die Ausbildung einer neuen Generation von Taxonom*innen vorangetrieben. Vera Rduch promovierte 2013 an der Universität Bonn mit einer am LIB – Museum Koenig Bonn verfassten Arbeit über „Ecology and Population Status of the Puku Antelope (Kobus vardonii) in Zambia“, die 2014 mit dem Dissertationspreis der Alexander Koenig Gesellschaft ausgezeichnet wurde. Als passionnierte Säugetierkundlerin mit dem Fokus auf der Artenvielfalt der Boviden, ihren Populationen und ihren ökologischen Einnischungen im südlichen zentralen Afrika ist sie seitdem in Forschung, Naturschutz und Umweltbildung in Sambia involviert – und zudem Mitglied in der IUCN SSC Antelope Specialist Group. Weiterhin ist sie Autorin verschiedener Bücher wie Monografien oder Kinderbücher.
LIB Bonn 

Dr. Thomas Wesener
Thomas Wesener studierte an der Ruhr-Universität Bochum, promovierte in Bonn bevor er 2008–2010 einen Postdoc am Field Musuem, Chicago absolvierte. Seit 2011 ist er Kurator für Myriapoda am Museum Koenig, Bonn, Leibniz Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Er ist Experte für die Taxonomie, Morphologie und Phylogenie der Tausendfüßer, mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Diplopoda. Zur Zeit ist er der einizige hauptberufliche Kurator für Myriapoda in Deutschland. Besonderes Interesse liegt hier auf dem Thema Mikroendemiten sowie Tausendfüßer in Höhlen. Der Forschungsansatz ist integrativ und kombiniert genetische Daten, micro CT Scans und klassische Taxonomie.
LIB Bonn 

Dr. Ximo Mengual
Ximo Mengual promovierte 2008 an der Universität Alicante. Nach einem Postdoc am National Museum of Natural History (Washington, D.C.) arbeitete er für das US-Landwirtschaftsministerium, bevor er 2012 zum Museum Koenig Bonn, Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels, wechselte, wo er Kurator der Diptera-Sammlung und Leiter der Diptera-Sektion ist. Seine Forschung als Entomologe und Phylogenetiker konzentriert sich auf die Biologie, Evolutionsgeschichte und Taxonomie von echten Fliegen (Diptera) mit besonderem Schwerpunkt auf der weltweiten Familie Syrphidae, allgemein bekannt als Blumenfliegen oder Schwebfliegen. Darüber hinaus interessiert er sich für die Ökologie und die Larvenernährung von Blumenfliegen, um mögliche Evolutionsszenarien für diese äußerst vielfältigen Fliegen zu erforschen. In seiner Forschung verwendet er einen integrativen Ansatz und kombiniert Morphologie, Ökologie, DNA-Barcoding, Phylogenomik und vergleichende Genomik.
LIB Hamburg 

Dr. Dagmara Żyła
Dagmara Żyła promovierte 2013 an der University of Silesia in Polen. Später begann sie ihr erstes Postdoc am Natural History Museum of Denmark, wo sie bis 2017 arbeitete. 2018 erhielt sie das Marie Skłodowska-Curie Global Fellowship und absolvierte ihr zweites Postdoc an der Iowa State University (USA) und University of Gdańsk (Polen). Danach war sie erfolgreich bei der Einwerbung eines Stipendiums vom National Science Centre in Polen und wechselte 2020 als Assistenzprofessorin an das Museum und Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences. Dagmara begann ihre Arbeit als Kuratorin der Coleoptera und Leiterin der Coleoptera-Abteilung im Museum of Nature Hamburg, Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change, im Oktober 2021. Ihre Hauptforschungsgruppe sind Kurzflügelkäfer (Staphylinidae) und sie untersucht deren Phylogenie, Evolution, Systematik und Taxonomie. Ihre Forschung kombiniert verschiedene Methoden der systematischen Forschung mit modernen Werkzeugen der Genomik. Sie konzentriert sich auf die tropische Vielfalt einer der größten Unterfamilien der Staphylinidae, Paederinae, forscht aber auch zur lokalen Kurzflügelkäfer-Fauna in Hamburg. Zusätzlich integriert sie Informationen aus der Vergangenheit, indem sie fossile Funde in ihre Studien einbezieht.


Prof. Dr. Michael Matschiner
Michael Matschiner ist Direktor der Zoologischen Staatssammlung München (ZSM) – eine der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB) – und Professor für Systematische Zoologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Promoviert hat Michael Matschiner 2011 an der Universität Basel (Schweiz) zum Thema Evolution der Antarktisfische, danach folgten PostDoc-Aufenthalten an der University of Canterbury (Neuseeland), der University of Oslo (Norwegen), und der Universitäten Basel und Zürich (Schweiz). Bevor er im Dezember 2024 an die ZSM kam, war Michael Matschiner Associate Professor am Natural History Museum Oslo, wo er die Ichthyologische Sammlung kuratorisch betreut hat. Seine Forschung untersucht die Entstehung von Biodiversität anhand von adaptiven Radiationen, wie die der Buntbarsche im Tanganjikasee in Afrika und die der Antarktisfische im Südlichen Ozean.

Dr. Michael Raupach
Michael Raupach hat an der Ruhr-Universität Bochum studiert und promovierte am Lehrstuhl für Spezielle Zoologie im Jahr 2004 zum Thema „Molekulargenetische Analyse von Biogeographie, Speziation und Biodiversität der Asellota (Crustacea: Isopoda) der antarktischen Tiefsee“. Seit 2019 leitet er als Kurator die Sektion Hemiptera an der Zoologischen Staatssammlung München. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Erstellung von DNA-Barcoding-Bibliotheken für verschiedene Insektengruppen, insbesondere für Laufkäfer. Aktuelle Forschungsschwerpunkte umfassen die Systematik und Phylogenie von Wasserläufern und Wasserwanzen.


Dr. Amrita Srivathsan
Amrita Srivathsan absolvierte eine gemeinsame Promotion an der National University of Singapore und dem Imperial College London. Anschließend setzte sie ihre Forschung als Postdoktorandin an der National University of Singapore fort. Im Jahr 2021 begann sie ihre Position am Museum für Naturkunde Berlin im Center for Integrative Biodiversity Discovery. Ihre Forschung am MfN konzentriert sich auf die Entwicklung benutzerfreundlicher Werkzeuge für groß angelegte NGS-Barcoding-Projekte mit Oxford Nanopore sowie auf die Nutzung von Metagenomik und Metabarcoding zur Charakterisierung von Arteninteraktionen anhand von Umweltproben.

Dr. Joshua Peñalba
Joshua Peñalba ist ein Evolutionsbiologe mit Schwerpunkt auf Museomik, Populationsgenomik und Artbildung. Er promovierte an der Australian National University (Canberra) über vergleichende Hybridisierung und Artbildung. Anschließend absolvierte er ein Postdoc an der Ludwig-Maximilians-Universität (München) und arbeitete an der Variation der Rekombinationsrate. Im Jahr 2021 begann er seine Position am Museum für Naturkunde Berlin im Center for Integrative Biodiversity Discovery. Dort konzentriert er sich auf die Entwicklung von Protokollen und Pipelines zur Nutzung von DANN aus Museumsexemplare für die Biodiversitäts- und Evolutionsforschung. Sein Forschungsziel ist es, die Rolle von Geographie und Genom bei der Gestaltung von Divergenz und Genfluss während der Artbildung zu verstehen.

Dr. Francisco Hita Garcia
Francisco Hita Garcia ist ein Systematiker, der sich für die Biodiversität und Evolution von Ameisen auf verschiedenen räumlichen und organismischen Ebenen interessiert. Er promovierte am Museum Alexander Koenig und der Universität Bonn. Anschließend war er Postdoktorand an der California Academy of Sciences in San Francisco, gefolgt von einer Position als Kurator für Wirbellose am Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Danach zog er nach Japan, um als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Okinawa Institute of Science and Technology zu arbeiten. Im Jahr 2022 kehrte er nach Deutschland zurück und trat dem Center for Integrative Biodiversity Discovery am Museum für Naturkunde Berlin bei.

Prof. Dr. Rudolf Meier
Rudolf Meier ist Leiter des „Center for Innovative Biodiversity Discovery“ (CIBD) im Museum für Naturkunde Berlin. Das Zentrum konzentriert sich auf die Verbesserung der Biodiversitätsforschung durch die Entwicklung neuer Methoden zur Beschleunigung der Entdeckung, Beschreibung und Identifizierung von Arten. Durch den Einsatz moderner Technologien und klassischer Methoden hilft das CIBD bei der Erstellung eines umfassenden Inventars bekannter und unbekannter Tierarten. Durch globale Zusammenarbeit und die Entwicklung von Hochdurchsatz-Workflows hofft das CIBD, die Taxonomie zu beschleunigen, die Überwachung der biologischen Vielfalt zu erleichtern und eine ganzheitliche Untersuchung von Anpassungen und Umweltveränderungen zu ermöglichen.
Freischaffender Biologe

Dr. Rüdiger Schmelz
Rüdiger M. Schmelz ist taxonomischer Experte für Enchytraeiden, einer meist bodenlebenden Familie von Kleinringelwürmern. Er studierte an der Universität Freiburg i. Br. Biologie und Philosophie und wurde an der Universität Osnabrück 2002 mit einer taxonomischen Revision der artenreichen Gattung Fridericia als Dr. rer. nat. promoviert. Sein Forschungsschwerpunkt bleibt die Artendiversität der Familie Enchytraeidae, mit Neubeschreibungen, Revisionen, Bestimmungsschlüsseln, und Arbeiten zur Verbreitung und Autökologie der Arten. Er ist ansässig in Spanien und arbeitet freiberuflich im Rahmen von bodenökologischen Projekten im europäischen Raum.
