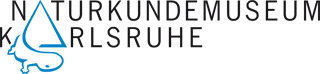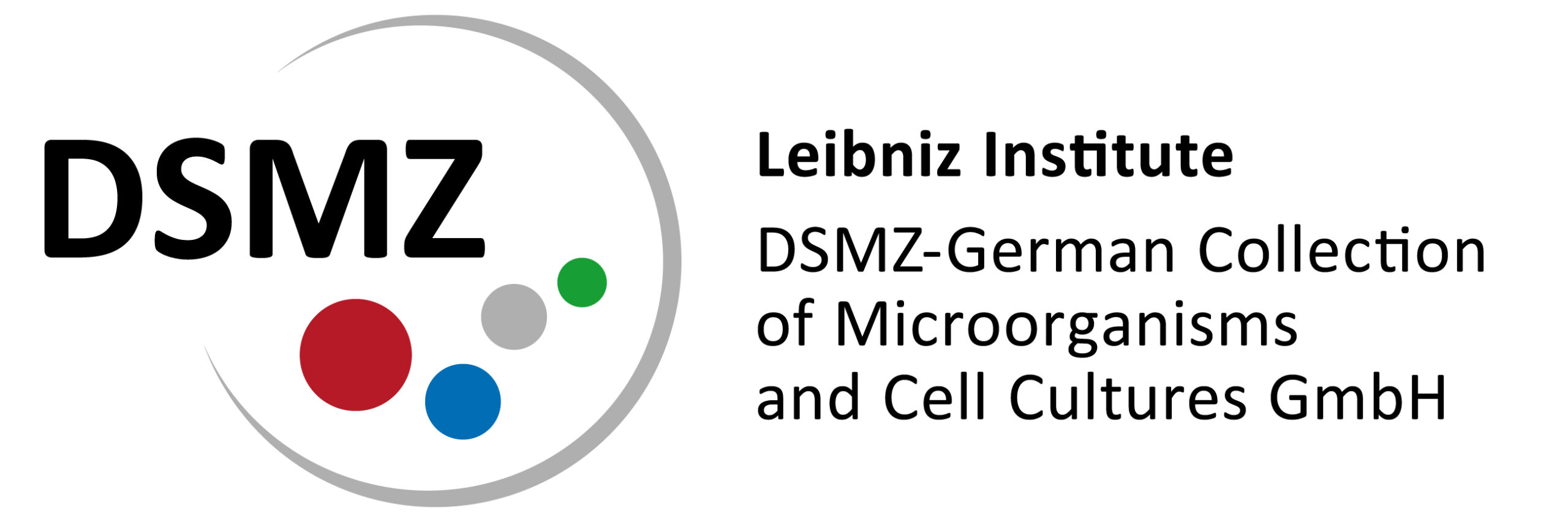Forschungsinstitute
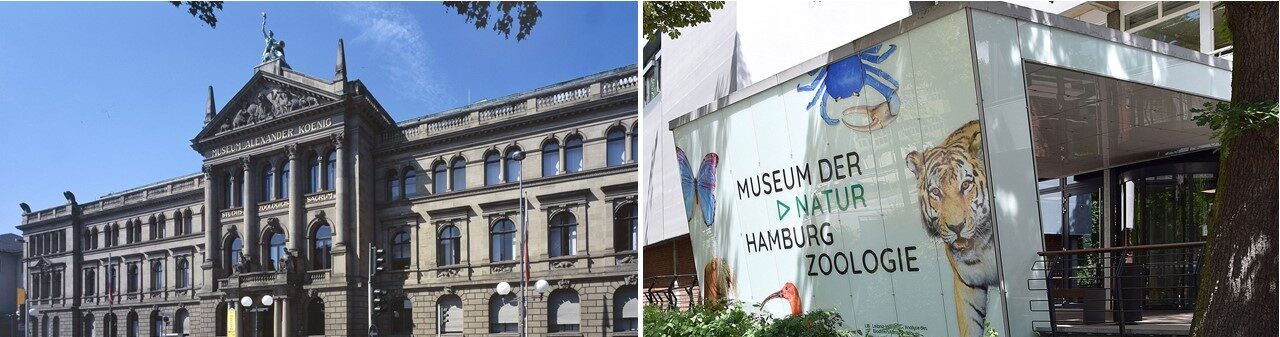

Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels
Museum Koenig Bonn
Adenauerallee 160
53113 Bonn
Museum der Natur Hamburg
Martin-Luther-King-Platz 3
20146 Hamburg
Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB)
Das Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) widmet sich der Erforschung der biologischen Vielfalt und ihrer Veränderung, deren Ergebnisse aufklärend in die breite Gesellschaft getragen werden. Um das derzeitige Massensterben von Flora und Fauna besser zu verstehen, suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Zusammenhängen und Ursachen von – häufig – menschengemachten Veränderungen. Das Ziel ist, Lösungen für den Erhalt von Ökosystemen und Arten zu entwickeln, um die Grundlage jetzigen Lebens zu erhalten.
Das LIB zählt zur Gruppe der acht großen Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Es setzt sich aus dem Mueum Koenig Bonn (ehemals Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig – Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere), und dem Museum der Natur Hamburg (ehemals Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg) zusammen, die am 1. Juli 2021 auf einen Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) im LIB zusammengeführt wurden.
Das LIB umfasst mehr als 16 Millionen Sammlungsobjekte, vornehmlich aus dem Bereich der Zoologie, aber auch aus der Geologie-Paläontologie und Mineralogie. Mithilfe modernster Technologien untersuchen Forschende den Wandel der Biodiversität auf der Basis dieser wertvollen, historischen Objektdatenbank, um relevante Fragen unserer Gesellschaft für die Zukunft zu beantworten. Durch die Sammlungsobjekte können sie Veränderungen beschreiben, die teils menschengemacht sind, und zukünftige Entwicklungsszenarien modellieren. Als integriertes Forschungsmuseum fördert das LIB innovative Forschung. Dokumentation, Erschließung und der Ausbau der Sammlungen sind wichtige Ziele dieser Forschungsinfrastruktur.
Am LIB dokumentieren und analysieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit in internationalen Netzwerken die Vielfalt auch bedrohter Arten, deren Evolution und Ökologie sowie zugrundeliegende genetische Prozesse. Dabei blicken sie zurück in die Erdgeschichte, rekonstruieren die Entwicklung von Arten und analysieren den aktuellen Einfluss von uns Menschen auf die Umwelt.
Das LIB trägt grundlegendes und ständig neu erworbenes Wissen in die Gesellschaft. In Ausstellungen, Veranstaltungen, wissenschaftlichen Tagungen, Publikationen und anderen Bildungs- und Kommunikationsformaten geht es essentiellen Fragen auf den Grund. Die Zusammenarbeit mit Schulen, Universitäten sowie weiteren Einrichtungen aus den Bereichen Bildung, Politik, Naturschutz und Kultur ist ein wichtiger Bestandteil der Aufgaben. Das LIB gewährt Zugang zu verschiedenen Serviceeinrichtungen wie Bibliotheken und Gen-Datenbanken. Als internationale Einrichtung, fördert das LIB die Erforschung seiner Sammlungen durch externe Forscher.
Viele Projekte zu Erfassung und Erforschung von Biodiversität führt das LIB an oder ist an ihnen beteiligt. Hier seien einige Beispiele genannt: Das LIB leitet das German Barcode of Life Projekt (GBOL) seit seinem Beginn in 2011 (https://gbol.bolgermany.de/). Mit einer umfassenden Arteninventur in Deutschland wird eine öffentlich zugängliche DNA-Barcode-Referenzdatenbank erstellt. In der dritten Phase GBOL III: Dark Taxa liegt zu diesem Ziel ein besonderer Fokus auf ausgewählten Gruppen der megadiversen parasitoiden Wespen und Mücken & Fliegen mit zugleich der Ausbildung einer neuen Generation von Taxonom*innen. Mit CaBOL (Caucasus Barcode of Life; https://ggbc.eu/ ) wird die Expertise aus GBOL zu Erfassung und Katalogisierung der Tier- und Pflanzenarten im Südkaukasus (Georgien und Armenien) seit 2020 exportiert. Hier reiht sich das BIO-GEEC-Projekt ein (German-Ecuadorian Biodiversity Consortium; ), das die Beschleunigung der Identifizierung verschiedener Organismen in Ecuador anstrebt. In diesem Kontext ist auch Biodiversity Genomics Europe (BGE; https://biodiversitygenomics.eu/ ) anzuführen. Diversität und Verbreitung nicht heimischer Arten in Norddeutschland wird seit 2021 in Neobiota-Nord dokumentiert (https://www.neobiota-nord.de/ ). Förderung von Artenkenntnis und Taxonomie wird durch Projekte wie FörTax (Förderung von taxonomischem Wissen als Grundlage für den Naturschutz; https://foertax.de/ ) oder der Leibniz-Taxonomie-Werkstatt erreicht.
Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) Projekte
Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) Forschende
LIB Bonn 

Dr. Ralph S. Peters
Ralph S. Peters ist Wissenschaftler, Entomologe und Kurator. Seinen Doktor erwarb er an der Universität Hamburg; seit 2011 arbeitet er am Museum Koenig Bonn, Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Seine Hauptforschungsinteressen sind die Taxonomie, Biologie und Evolutionsgeschichte der Hymenopteren, mit einem Schwerpunkt auf parasitoide Wespen. Er bearbeitet diese Forschungsinteressen mit einem interdisziplinären und integrativen Ansatz, der Morphologie, Verhalten und Feldstudien, DNA Barcoding, „Taxonomics“, Phylogenomik und vergleichende Genomik umfasst. Er kuratiert außerdem eine große wissenschaftliche Sammlung am Museum Koenig Bonn und trägt aktiv zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Wissenstransfer des Museums bei. Im Rahmen seiner Forschung war er Co-Koordinator des 1KITE Projektes zur Insektenevolution und leitet zurzeit das Projekt GBOL III: Dark Taxa, eine Biodiversitätsentdeckungs- und DNA-Barcodinginitiative mit Fokus auf schlecht bearbeitete megadiverse Insektengruppen in Zentraleuropa.
LIB Hamburg 

Dr. Nancy Mercado Salas
Nancy Mercado Salas hat im Dezember 2013 am El Colegio de la Frontera Sur (Mexiko) promoviert. Nach einem Postdoc am Deutschen Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung (Senckenberg am Meer, Wilhelmshaven) wurde sie Kuratorin und Leiterin der Sektion Crustacea am Centrum für Naturkunde (CeNak - Universität Hamburg). Mit der Fusion von CeNak und ZMFK setzt sie ihre Tätigkeit in der Crustacea-Sektion des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) fort. Ihre Forschung konzentriert sich auf das Verständnis der evolutionären Prozesse, die die Vielfalt der Krebse geformt haben, insbesondere die Prozesse, die mit der Besiedlung und Etablierung in neuen Lebensräumen zusammenhängen. Ihr besonderes Interesse gilt Umgebungen, die „lebende Laboratorien“ darstellen (z. B. Phytotelmata, Anchialin-Höhlen und Grundwassersysteme), in denen wir eine Vielzahl von Fragen im Zusammenhang mit Artbildung, Biogeografie, Populationsgenetik und Evolution verfolgen können. Nancys taxonomisches Fachwissen bezieht sich auf die Unterklasse der Copepoda, insbesondere auf Mitglieder der Ordnung Cyclopoida und ausgewählte Gruppen der Harpacticoida. Sie ist auch an neuen bildgebenden Verfahren (z. B. CLSM-Mikroskopie) und molekularen Werkzeugen (z. B. Barcoding, Metabarcoding) interessiert, die dazu beitragen, die Beschreibung von Arten und Gemeinschaften der Meiofauna zu beschleunigen.
LIB Bonn 

Dr. Vera Rduch
Vera Rduch arbeitet seit 2014 für das German Barcode of Life (GBOL) Projekt am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels – Museum Koenig Bonn. Seit Jahresbeginn 2019 erfüllt sie die Aufgabe der Zentralen Koordination des GBOL-Konsortium. Damit war und ist sie entscheidend an der Entwicklung und erfolgreichen Durchführung von GBOL III: Dark Taxa beteiligt. In diesem Projekt, eine Barcoding- und Biodiversitäts-Initiative, werden sich gegenseitig bedingend der Ausbau der DNA-Barcode-Referenzbibliothek, die Erforschung der Dark Taxa (ausgewählte Gruppen der parasitoide Wespen und nematoceren Diptera) sowie die Ausbildung einer neuen Generation von Taxonom*innen vorangetrieben. Vera Rduch promovierte 2013 an der Universität Bonn mit einer am LIB – Museum Koenig Bonn verfassten Arbeit über „Ecology and Population Status of the Puku Antelope (Kobus vardonii) in Zambia“, die 2014 mit dem Dissertationspreis der Alexander Koenig Gesellschaft ausgezeichnet wurde. Als passionnierte Säugetierkundlerin mit dem Fokus auf der Artenvielfalt der Boviden, ihren Populationen und ihren ökologischen Einnischungen im südlichen zentralen Afrika ist sie seitdem in Forschung, Naturschutz und Umweltbildung in Sambia involviert – und zudem Mitglied in der IUCN SSC Antelope Specialist Group. Weiterhin ist sie Autorin verschiedener Bücher wie Monografien oder Kinderbücher.
LIB Hamburg 

Dr. Jenna Moore
Jenna Moore schloss im Dezember 2019 ihre Promotion an der University of Florida (USA) ab. Ihr Schwerpunkt lag auf der Evolution und Systematik mariner Anneliden. Im Jahr 2020 erhielt sie ein NSF-Postdoktorandenstipendium und arbeitete am Dauphin Island Sea Lab (USA) an der morphologischen Evolution mariner Anneliden. Anfang 2022 kam sie als Kuratorin und Leiterin der Abteilung Annelida zum LIB. Ihre Forschungsinteressen sind die Evolution von Form und Funktion, Systematik, Taxonomie und Biogeographie mariner wirbelloser Tiere, insbesondere mariner Anneliden. Jennas taxonomischer Schwerpunkt liegt auf den marinen Annelida, insbesondere der Familie Chaetopteridae, aber auch auf anderen marinen Anneliden. Sie setzt moderne bildgebende und molekulare Verfahren ein, um die Entdeckung der biologischen Vielfalt zu beschleunigen, Arten zu charakterisieren, ihre Evolutionsgeschichte zu rekonstruieren und die Zusammenhänge in der Meereswelt zu verstehen. Ihr besonderes Interesse gilt den unbekannten Arten aus dem Flachwasserbereich der Meere, aber sie hat auch an Arbeiten auf Schiffen in der Antarktis und den Subtropen teilgenommen. Jenna Moore verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit der Makrofotografie im Feld, der Entnahme von Gewebeproben, der Konservierung und der schnellen musealen Erfassung aller marinen Makroinvertebratengruppen, um die Artenvielfalt umfassend zu erfassen und Daten zur biologischen Vielfalt offen und zugänglich zu machen.
LIB Hamburg 

Dr. Dagmara Żyła
Dagmara Żyła promovierte 2013 an der University of Silesia in Polen. Später begann sie ihr erstes Postdoc am Natural History Museum of Denmark, wo sie bis 2017 arbeitete. 2018 erhielt sie das Marie Skłodowska-Curie Global Fellowship und absolvierte ihr zweites Postdoc an der Iowa State University (USA) und University of Gdańsk (Polen). Danach war sie erfolgreich bei der Einwerbung eines Stipendiums vom National Science Centre in Polen und wechselte 2020 als Assistenzprofessorin an das Museum und Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences. Dagmara begann ihre Arbeit als Kuratorin der Coleoptera und Leiterin der Coleoptera-Abteilung im Museum of Nature Hamburg, Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change, im Oktober 2021. Ihre Hauptforschungsgruppe sind Kurzflügelkäfer (Staphylinidae) und sie untersucht deren Phylogenie, Evolution, Systematik und Taxonomie. Ihre Forschung kombiniert verschiedene Methoden der systematischen Forschung mit modernen Werkzeugen der Genomik. Sie konzentriert sich auf die tropische Vielfalt einer der größten Unterfamilien der Staphylinidae, Paederinae, forscht aber auch zur lokalen Kurzflügelkäfer-Fauna in Hamburg. Zusätzlich integriert sie Informationen aus der Vergangenheit, indem sie fossile Funde in ihre Studien einbezieht.
LIB Bonn 

Dr. Ximo Mengual
Ximo Mengual promovierte 2008 an der Universität Alicante. Nach einem Postdoc am National Museum of Natural History (Washington, D.C.) arbeitete er für das US-Landwirtschaftsministerium, bevor er 2012 zum Museum Koenig Bonn, Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels, wechselte, wo er Kurator der Diptera-Sammlung und Leiter der Diptera-Sektion ist. Seine Forschung als Entomologe und Phylogenetiker konzentriert sich auf die Biologie, Evolutionsgeschichte und Taxonomie von echten Fliegen (Diptera) mit besonderem Schwerpunkt auf der weltweiten Familie Syrphidae, allgemein bekannt als Blumenfliegen oder Schwebfliegen. Darüber hinaus interessiert er sich für die Ökologie und die Larvenernährung von Blumenfliegen, um mögliche Evolutionsszenarien für diese äußerst vielfältigen Fliegen zu erforschen. In seiner Forschung verwendet er einen integrativen Ansatz und kombiniert Morphologie, Ökologie, DNA-Barcoding, Phylogenomik und vergleichende Genomik.