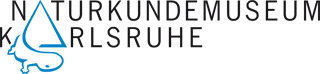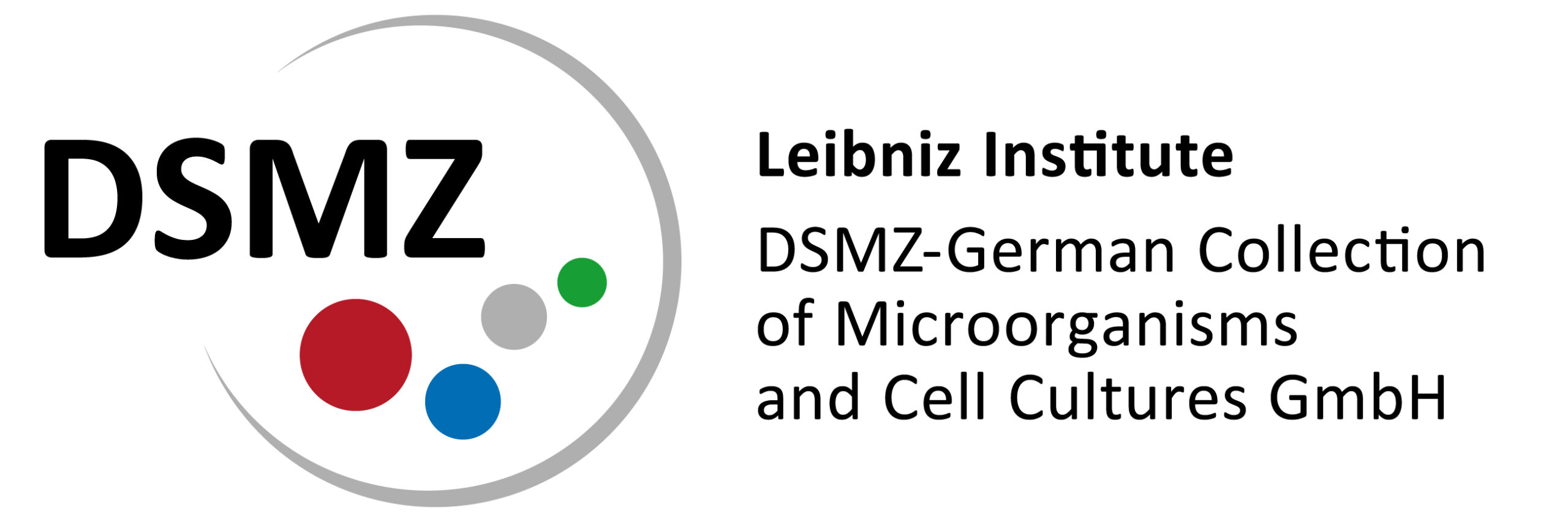Forschungsinstitute
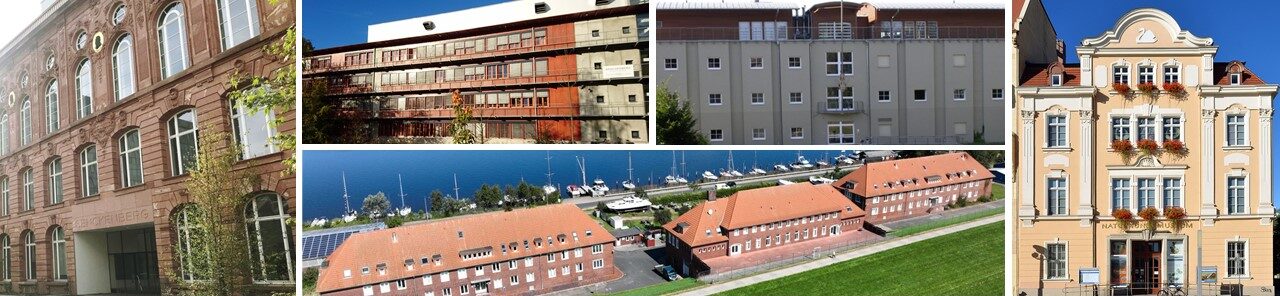
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
Das Leibniz-Institut Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) besteht aus acht Forschungsinstituten und ist über zwölf Standorte deutschlandweit verteilt. Drei dieser Forschungsinstitute – Frankfurt, Dresden und Görlitz – beinhalten ebenfalls ein Naturkundemuseum. Außerdem engagieren sich Mitarbeiter*innen der SGN als Professor*innen und Dozent*innen an der Goethe Universität Frankfurt a.M., Justus-Liebig-Universität Gießen, der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, der Universität Potsdam, der Technischen Universität Dresden und weiteren Universitäten in der universitären Lehre.
Der wissenschaftliche Schwerpunkt von Senckenberg liegt in der Erforschung der Rolle der Biodiversität, inklusive der Menschheit, für die Entwicklung des Erdsystems von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft. Damit leistet sie einen wichtigen und international anerkannten Beitrag zum Verständnis, der Bewahrung und nachhaltigen Nutzung der Natur. Forschungsschwerpunkte der Senckenberg Standorte sind z.B. Bodenzoologie (Görlitz), Meeresbiologie (Wilhelmshaven), Klimawandelforschung (SBiK-Frankfurt), Entomologie (Müncheberg), molekulare Biodiversität (TBG-Loewe Zentrum Frankfurt), Taxonomie und Systematik (Dresden).
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung Projekte
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung Forschende
Senckenberg Görlitz 

Dr. Karin Hohberg
Karin Hohberg studierte Biologie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und promovierte am Lehrstuhl für Tierökologie der Universität Bielefeld zum Thema „Nematoden im Bodennahrungsnetz“. Seit 2009 leitet sie die Sektion Nematoda am Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz. Neben ökologischen Fragestellungen rund um frei lebende Fadenwürmer liegt ihr Forschungsschwerpunkt in Aufbau und Struktur von Artengemeinschaften und Bodennahrungsnetzen, die sie vorrangig in sehr jungen oder hochgradig gestörten Böden in extremen Lebensräumen untersucht, darunter Braunkohletagebaue, antarktische Böden, natürliche CO2-Ausgasungsfelder, heiße Quellen und Sanddünen in der Namib Wüste.
Senckenberg Görlitz 

Dr. Nicole Scheunemann
Nicole Scheunemann studierte Biologie an der TU Darmstadt und promovierte im Jahr 2016 an der Universität Göttingen zum Thema Ökologie von Springschwänzen (Collembolen) und deren Stellung im Nahrungsnetz des Bodens. Seit 2018 forscht sie am Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz zur Artenvielfalt und Gemeinschaftsstruktur von Collembolen in norddeutschen Auenwäldern, welchen Einfluss sie auf Ökosystemleistungen haben, und auf welche Art sie am besten zu schützen sind. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Forschung ist die Veränderung von Artengemeinschaften von Bodentieren im Zuge des Klimawandels und die Auswirkungen dieser Veränderungen auf Ökosystemleistungen.
Senckenberg Görlitz 

Dr. Ricarda Lehmitz
Ricarda Lehmitz hat an der Universität Potsdam Biologie studiert. In ihrer Promotion an der Universität Leipzig beschäftigte sie sich mit den Verbreitungswegen von Hornmilben (Oribatida). Seit 2013 leitet sie die Sektion Oribatida innerhalb der Abteilung Bodenzoologie am Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz. Aktuell untersucht sie unter anderem den Einfluss von Störungen und Renaturierung auf die Artenzusammensetzung der Hornmilben in Mooren und erarbeitet die erste Rote Liste der Hornmilben für Deutschland.
Senckenberg Görlitz 

Dr. Clément Schneider
Clément Schneider studierte Lebens- und Evolutionswissenschaften an der Universität Pierre und Marie Curie, Paris 6. 2014 promovierte er am National Museum of Natural History in Paris über die Taxonomie und Phylogenetik der Collembola. Danach arbeitete er in der Privatwirtschaft als Datenwissenschaftler, der an Projekten im Bereich Big Data und maschinelles Lernen beteiligt war. Seit 2019 ist er zurück in der Wissenschaft, bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (Frankfürt am Main, dann Görlitz), wo er an der Genomik der wirbellosen Bodenfauna arbeitete und nun die Anwendung von KI-Methoden entwickelt, um die Komplexität von Bodenfauna-Gemeinschaften im Allgemeinen zu erfassen und speziell das Wissen über die Artenvielfalt von Springschwänzen auf der ganzen Welt zu erweitern.
Senckenberg Görlitz 

Prof. Dr. Anton Potapov
Anton Potapov ist Bodenökologe und erforscht die Rolle von Tieren für das Funktionieren von Ökosystemen. Er schloss sein Studium an der Staatlichen Universität Moskau 2011 ab und arbeitet seit 2016 in Deutschland. Seit 2024 leitet er die Abteilung für Bodenzoologie am Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz. Seine größte Leidenschaft und Expertise sind Nahrungsnetze im Boden. Er koordiniert das globale Monitoring von Bodentiergemeinschaften - Soil BON Foodweb.
Senckenberg am Meer 

Prof. Dr. Pedro Martínez Arbizu
Pedro Martínez Arbizu ist Leiter des Deutschen Zentrums für Marine Biodiversitätsforschung in Wilhelmshaven. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit der Taxonomie von benthischen Copepoden und anderer Crustaceen. Neben der taxonomischen Arbeit untersucht Prof. Dr. Pedro Martínez Arbizu die Verbreitung interstitieller Fauna im Flachwasser und der Tiefsee unter Nutzung moderner technischer Lösungen und DNS Methoden. Unter den zahlreichen Projekten, die von ihm geleitet wurden war unter anderem das Census of Diversity of Abyssal Marine Life (CeDaMar) in dem die unbekannte Fauna der Tiefsee erforscht und beschrieben wurde.
Senckenberg am Meer 

PD Dr. Mona Hoppenrath
Mona Hoppenrath studierte Biologie in Göttingen und promovierte 2000 in Hamburg. Als Postdoc war sie an der Biologischen Anstalt Helgoland und der Wattenmeerstation Sylt des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung tätig, bevor sie 2004 an die University of British Columbia, Kanada, wechselte. Sie ist seit 2008 Fachbereichsleiterin der Meeresbotanik des DZMB, Senckenberg am Meer Wilhelmshaven. Ihr Forschungsschwer- punkt liegt auf der Taxonomie, Systematik und Phylogenie der Dinoflagellaten. 2012 habilitierte sie an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, an der sie als Privatdozentin tätig ist.
Senckenberg am Meer 

Dr. Sven Rossel
Sven Rossel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung in Wilhelmshaven. Er promovierte 2018 über die Diversität benthischer Copepoden der Nordsee. Neben der taxonomischen Arbeit beschäftigt er sich außerdem mit der Anwendung molekularer Methoden zur schnelleren Identifikation von Organismen. Neben dem genetischen Barcoding liegt ein Fokus dabei beim Proteome fingerprinting, einer Methode, die schnell erzeugte Proteinmassenspektren nutzt um Individuen auf Artebene zu identifizieren.
Senckenberg am Meer 

Dr. Alexander Kieneke
Alexander Kieneke studierte Biologie mit den Schwerpunkten Zoomorphologie und Systematik an der Universität Bielefeld und schloss das Studium 2004 als Diplombiologe ab. Nach seiner Promotion 2008 an der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg trat er eine Postdoc-Stelle in der Abteilung Deutsches Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung (DZMB) des Instituts Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven an. Seit 2012 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am DZMB und erforscht die Merkmalsevolution und Bio- sowie Phylogeographie von Meiofauna-Organismen mit verschiedenen Techniken. Von den kleinen Bodentieren interessieren ihn besonders die Bauchhärlinge (Gastrotricha).
Senckenberg BiK-F Frankfurt 

Dr. Valentyna Krashevska
Valentyna Krashevska promovierte 2008 an der TU Darmstadt, wo sie Bodenprotistengemeinschaften in montanen Regenwaldökosystemen entlang eines Höhengradienten untersuchte. Seit 2009 arbeitete sie an der Universität Göttingen im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 990: Ökologische und sozioökonomische Funktionen tropischer Tieflandregenwald-Transformationssysteme, wo sie die Struktur und Funktion des Zersetzersystems in Tieflandregenwald-Transformationssystemen untersuchte. Sie nutzte Umwelt-DNA zum Nachweis der Vielfalt des Bodenmikrobioms und konzentrierte ihre mikroskopischen Arbeiten auf Thekamöben, die schönsten, ältesten und nützlichsten Indikatororganismen. Seit 09.2023 arbeitet sie am Senckenberg-BiK-F an der Standardisierung von genetischen Methoden zur Bewertung der Bodenqualität.