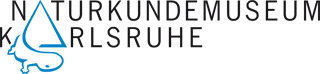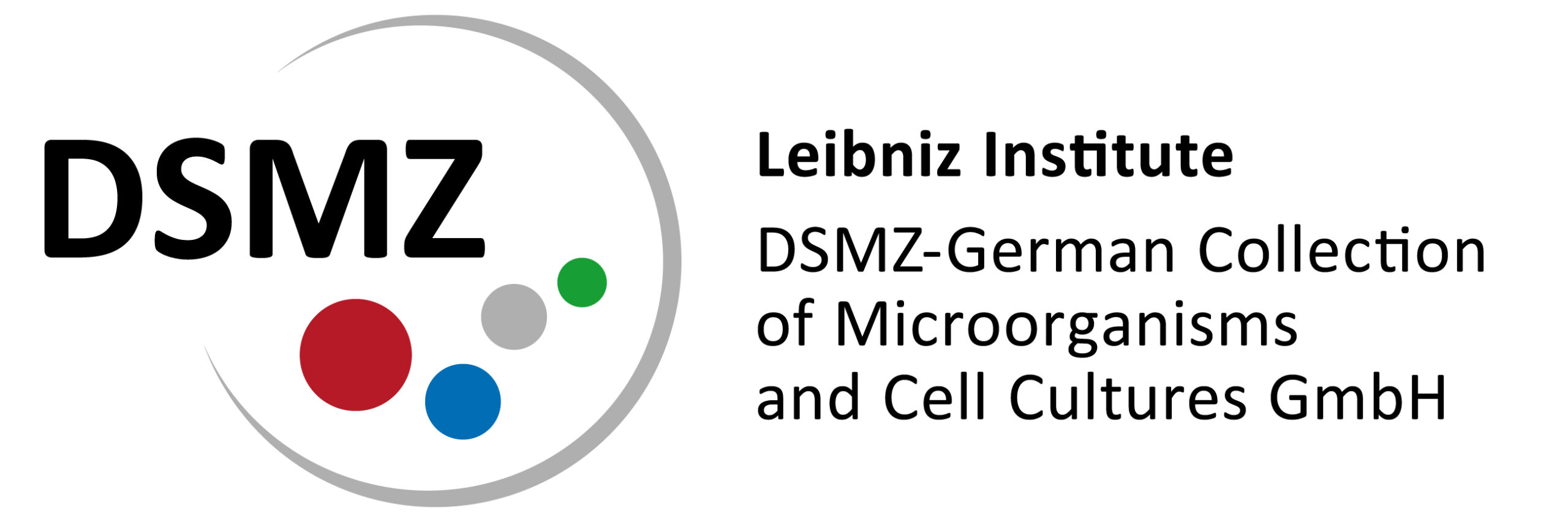Projekte
Unbekanntes Deutschland TrenDiv - Trends in versteckten Taxa und Habitaten

Für ein besseres Verständnis des Ausmaßes und der Auswirkungen der Biodiversitätskrise
Der Verlust der biologischen Vielfalt ist eine der dringendsten Herausforderungen unserer Zeit. Er steht in engem Zusammenhang mit dem Rückgang der Ökosystemleistungen. Daher ist ein tiefes Verständnis der ökologischen Folgen von Biodiversitätsveränderungen unerlässlich für die Etablierung von Naturschutzmaßnahmen und für eine angemessene Reaktion auf die sich abzeichnende Biodiversitätskrise.
Im Rahmen des TrenDiv-Projekts untersuchen wir zeitliche Veränderungen auf allen Ebenen der Biodiversität (Arten, Lebensgemeinschaften, genetisch und funktional), indem wir Standorte in Deutschland, die vor 25 bis 45 Jahren auf ihre Biodiversität hin untersucht wurden, erneut beproben. Wir konzentrieren uns auf Taxa aus unbekannten Lebensräumen, die wenig erforscht, aber funktionell wichtig sind:
• Meso- und Mikrofauna des Bodens: Wir werden 45 Standorte mit unterschiedlichen Lebensräumen (Grünland, Wald, Landwirtschaft) in ganz Deutschland neu beproben und Gemeinschaften und funktionelle Merkmale von Collembola, Oribatida, Nematoda und Enchytraeidae identifizieren. Dieses Teilprojekt wird von Senckenberg Görlitz geleitet.
• Fluginsekten: Die Biodiversität hyperdiverser Gruppen (z.B. Hymenoptera, Diptera) wird anhand von Malaisefallen-Proben aus der „Krefeld-Studie“ analysiert, die bereits einen starken Rückgang der Insektenbiomasse in Deutschland nachgewiesen hat. Dieses Teilprojekt wird vom Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart geleitet.
• Meiofauna aquatischer Sedimente: Die Gemeinschaftsstruktur von Copepoda, Isopoda und Amphipoda in 50 Quellen, Brunnen und Nordseesedimenten wird bewertet und ihre Mundwerkzeuge werden auf funktionelle Merkmale untersucht. Dieses Teilprojekt wird vom LIB Hamburg und Senckenberg am Meer geleitet.
• Mikrobiome: In kürzlich beprobten Exemplaren sowie in Sammlungsmaterial werden Veränderungen in den komplexen Mikrobiomen der jeweiligen Arten analysiert. Die mikrobiellen Merkmale geben Aufschluss über Veränderungen in der Umwelt sowie über die ökologischen Funktionen ihrer Wirte. Dieses Teilprojekt wird vom DSMZ geleitet.
Modernste Methoden wie (Meta-)Barcoding, Metagenomik, Proteomik, komponentenspezifische Analyse stabiler Isotope und Rasterelektronenmikroskopie werden es uns ermöglichen, Veränderungen im Artenreichtum und in der Biomasse sowie in der Zusammensetzung der Gemeinschaft zu bewerten. Die funktionelle Struktur der wirbellosen und mikrobiellen Gemeinschaften wird anhand von funktionellen und morphologischen Merkmalen bewertet. Durch ökologische Modellierung werden wir Aufschluss über mögliche Veränderungen der Ressourcenverfügbarkeit, der Struktur des Nahrungsnetzes, der Ökosystemleistungen wie Bestäubung und Kohlenstoff- und Nährstoffflüsse sowie der ökologischen Nischen einzelner Arten erhalten. Durch die Verknüpfung der Dynamik der biologischen Vielfalt mit dem potenziellen Verlust ökologischer Funktionen wird dieses Projekt einen entscheidenden Beitrag zum Verständnis der Biodiversitätskrise leisten und politischen Entscheidungsträgern wichtige Informationen liefern.
Im Projekt beteiligte Wissenschaftler*innen (nach Instituten)
Projekte Datenbank
Edaphobase
Edaphobase ist eine open-access Datenbank für Bodenbiodiversitat. Edaphobase verbindet Daten aus unterschiedlichen Quellen von Bodentieren, ihrer Verbreitung und der Habitatparameter am Ort ihres Vorkommens und macht diese Daten für die Öffentlichkeit verfügbar. Edaphobase lebt von der Kooperation mit zahlreichen Bodenzoologen, die ihre Daten zu Edaphobase hochladen und so für verbindende Anylasen zur Verfügung stellen. Derzeit enthält Edaphobase Daten zu Nematoda, Collembola, Oribatida, Gamasina, Chilopoda, Diplopoda, Isopoda, Enchytraeidae und Lumbricidae. Edaphobase wird vom Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, Deutschland entwickelt und dauerhaft unterhalten.